Der Jahresabschluss stellt für ein Unternehmen das Ende eines Geschäftsjahres dar und umfasst wichtige Bestandteile wie die Erfolgs- und Geldflussrechnung oder die Bilanz. Im folgenden Artikel erfahren Sie, wer einen solchen jährlichen Abschluss verpflichtend erstellen muss und welche Firmen von dieser Regelung ausgeschlossen sind. Sie lernen ebenso die Bedeutung der Offenlegungspflicht, die Vorgehensweise bei der Erstellung sowie die Folgen von fehlerhaften Jahresabschlüssen kennen.

Unter dem sogenannten Jahresabschluss versteht man eine Darstellung des Erfolgs eines Unternehmens am Ende eines Geschäftsjahres. Das Ziel von jährlichen Geschäftsabschlüssen ist, dass Unternehmer selbst sowie relevante dritte Personen die wirtschaftliche Lage der Firma besser einschätzen können. Für den Jahresabschluss gibt es zudem gewisse Fristen, die beachtet werden müssen. So ist es für grosse Unternehmen erforderlich, die Erfolgsrechnung spätestens bis 90 Tage und für KMU 180 Tage nach dem Ablauf des laufenden Geschäftsjahres zu erstellen. Der jährliche Abschluss ist beim entsprechenden Finanzamt einzureichen, wobei die Daten elektronisch übermittelt werden können.
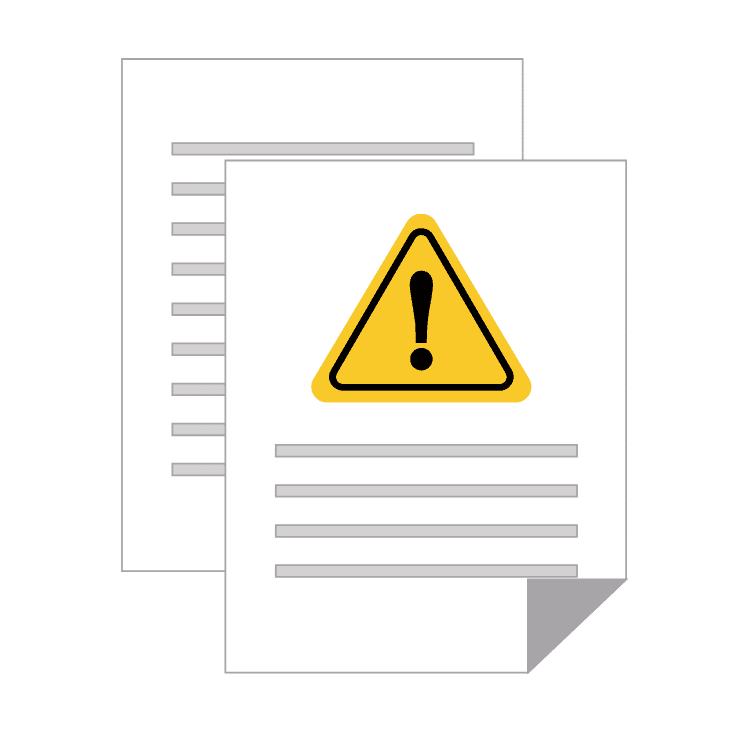
Es gibt in der Schweiz für gewöhnlich zwei mögliche Zeitspannen für ein Geschäftsjahr. So beginnt ein Geschäftsjahr entweder am 01.01. und endet am 31.12 oder es reicht vom 01.07. bis zum 30.06.
Die Schweizer Rechtslage sieht gemäss Art. 957 des Obligationenrechts (OR) einen Jahresabschluss für Einzelfirmen und Gesellschaften mit einem Erlös von mindestens 500 000 Schweizer Franken im letzten Jahr sowie für juristische Personen vor. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind jene Stiftungen und Vereine, die keine Eintragung in das Handelsregister vornehmen müssen. Zudem sind auch jene Stiftungen, die laut Art. 83b des Zivilgesetzbuches (ZGB) keine Revision durchführen lassen müssen, davon befreit, einen Jahresabschluss zu verfassen. Insgesamt sind also folgende juristische Personen dazu verpflichtet:
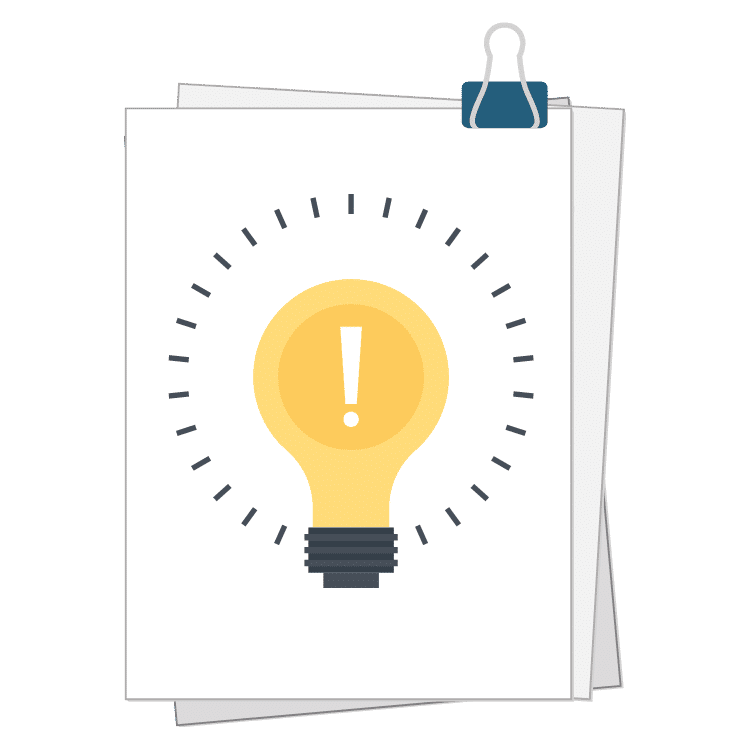
Wenn Einzelkaufleute in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren einen bestimmten maximalen Gewinn erzielen und auch pro Jahr nur eine gewisse Höhe des Jahresüberschusses erreicht haben, kann die Verpflichtung wegfallen. Wer tatsächlich davon befreit ist, einen Jahresabschluss zu erstellen, muss im Einzelfall geprüft werden.
Jahresabschlüsse unterliegen in der Schweiz nach Art. 958e des Obligationenrechts (OR) unter gewissen Umständen der sogenannten Offenlegungspflicht. Wenn das entsprechende Unternehmen also über ausstehende Anleihensobligationen oder an der Börse kotierte Beteiligungspapier verfügt, dann muss der jährliche Geschäftsabschluss im Schweizerischen Handelsamtsblatt herausgegeben oder Personen, die die Einsicht innerhalb eines Jahres fordern, durch eine Kopie übermittelt werden. Andere Firmen müssen jenen Gläubigern, die ein schutzwürdiges Interesse belegen, den Zugang zum Jahresabschluss gewähren.
Eine Jahresrechnung muss bestimmte Bestandteile enthalten, um ordnungsgemäss zu sein. So ist es zum Beispiel notwendig, die Lohnbuchhaltung sowie das Vermögen und etwaige Schulden in den Geschäftsabschluss aufzunehmen. Zudem müssen auch Informationen wie der Name und die Adresse der Firma, das Datum der Gründung oder aber auch eine Darstellung der Tätigkeit sowie Erklärungen zu den anderen Inhalten des Jahresabschlusses befinden sich in einem Anhang. Insgesamt sind also folgende Angaben darin zu machen:
Einer der wichtigsten Inhalte eines Jahresabschlusses ist die sogenannte Bilanz, die ihre rechtliche Basis in Art. 959 des Obligationenrechts (OR) hat. Bei dieser handelt es sich um eine Rechnung, die sowohl das Kapital als auch das Vermögen umfasst. Hierbei müssen sowohl die Aktiva als auch mögliche Schulden, also die Passiva, angegeben werden. Es gilt zudem, dass beide Werte, also jener des Vermögens und des Kapitals, übereinstimmen müssen, also eine Bilanzgleichheit vorhanden sein muss. Das Ziel einer Bilanz ist also die Berechnung des Gewinns und hilft auch dabei, Verluste erkennen zu können. Sie liefert auch wichtige Informationen für Gläubiger oder mögliche zukünftige Darlehensgeber und ist somit auch für deren Schutz besonders relevant.
Durch die sogenannte Geldflussrechnung werden Änderungen der Geldmittel durch Ein- und Ausgänge innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bestimmt. Hierbei soll auch die Herkunft und der Gebrauch der liquiden Mittel nachgewiesen werden. Die Geldflussrechnung wird in drei verschiedene Aspekte eingeteilt: die operative, die Finanzierungs- sowie die Investitionstätigkeit. Allerdings müssen gemäss Art. 961 des Obligationenrechts (OR) lediglich Unternehmen, die der ordentlichen Revisionspflicht unterliegen, die Geldflussrechnung auch in ihren Jahresabschluss aufnehmen. Dennoch können auch andere Firmen, obwohl sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind, diese Rechnung für ihre eigene Planung nutzen und dadurch finanzielle Schieflagen vermeiden.
Es muss gemäss Art. 961c des Obligationenrechts (OR) auch ein sogenannter Lagebericht über die wirtschaftliche Situation der Firma im Jahresbericht vorhanden sein. Dieser soll beispielsweise durch die Beschreibung der Situationen zu Bestellungen und Aufträgen,
einer Beurteilung des Risikos, aussergewöhnlicher Vorfälle oder aber auch durch zukünftige Erwartungen den Verlauf des Geschäftsverlaufs zeigen. Wichtig hierbei ist, dass diese Schilderung nicht der tatsächlichen Berechnung im Jahresabschluss widerspricht. Der Lagebericht muss rechtlich gesehen also folgende Informationen umfassen:
Die Erfolgsrechnung muss ebenfalls einen Teil des Jahresabschlusses ausmachen und die entsprechenden rechtlichen Regelungen hierzu finden sich in Art. 959b des Obligationenrechts (OR). Dort wird die Gewinnlage der Firma im Laufe des Geschäftsjahres entweder als Produktions- oder als Absatzerfolgsrechnung dargestellt. Bei der ersten Variante, die auch als Gesamtkostenverfahren bekannt ist, ist es notwendig, den betriebsbezogenen Aufwand in verschiedene Arten zu unterteilen. Im Gegensatz dazu wird bei der Erfolgsrechnung nach Absatz, auch Umsatzkostenverfahren genannt, der Aufwand nach entsprechenden Funktionen gegliedert.
| Produktions- vs. Absatzerfolgsrechnung | |
|---|---|
| Produktionserfolgsrechnung | Absatzerfolgsrechnung |
| Nettoerlöse aus Lieferungen & Leistungen | Nettoerlöse aus Lieferungen & Leistungen |
| Bestandesänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen | Anschaffungs- oder Herstellungskosten der verkauften Produkte und Leistungen |
| Material- und Personalaufwand | Verwaltungsaufwand und Vertriebsaufwand |
| sonstiger betrieblicher Aufwand | Finanzaufwand und -ertrag |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens | betriebsfremder Aufwand und Ertrag |
| Finanzaufwand und -ertrag | ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag |
| betriebsfremder Aufwand und Ertrag | direkte Steuern |
| ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag | Gewinn und Verlust des Jahres |
| direkte Steuern | |
| Gewinn und Verlust des Jahres |
Durch die zahlreichen Aspekte ist es kein einfacher Prozess, einen Jahresabschluss zu erstellen. Dieser beginnt nicht erst bei der tatsächlichen Verfassung, sondern erfordert bereits eine ausreichende Vorbereitungsphase. So ist es sinnvoll, die für den Abschluss notwendigen Dokumente, wie beispielsweise eine Inventur der Aktiva und Passiva oder die Bildung von Rückstellungen, bereits frühzeitig vorzubereiten. Auch das Sammeln und Ordnen von Belegen und Unterlagen für eine Saldenbilanz der Jahresverkehrszahlen ist als Vorbereitung für den Jahresabschluss unerlässlich.
Sobald diese Phase beendet ist, kann damit begonnen werden, den Jahresabschluss, den Anhang und den Lagebericht zu erstellen. Diese Dokumente werden anschliessend an die zuständige Person übergeben, die diese sorgfältig prüft und bei einem positiven Urteil auch darauf unterschreiben muss. Aktiengesellschaften muss der jährliche Geschäftsabschluss dem Aufsichtsrat zur Überprüfung ausgehändigt und von diesem vor der Einreichung zugelassen werden. Diese erfolgt dann elektronisch an das zuständige Finanzamt. Da es sich bei der Erstellung eines Jahresabschlusses zudem um einen komplexen rechtlichen und zeitintensiven Vorgang handelt, ist es ratsam, diesen von einem Anwalt, der auch als Steuerberater arbeitet, durchführen zu lassen. Auf diese Weise können Unternehmer sich nicht nur auf andere relevante Aspekte fokussieren, sondern auch mögliche Fehler vermieden werden.
Da Jahresabschlüsse zahlreiche komplexe rechnerische Bestandteile enthalten, ist es durchaus möglich, dass Fehler dabei passieren. Diese werden in wesentliche Gliederungs- und qualitative Fehler unterteilt. Wenn falsche Angaben aus früheren Jahren nur die Gliederung der Bilanz, der Erfolgs- oder der Geldflussrechnung beeinflussen und sich dies nicht direkt auf die Resultate auswirkt, kann der Fehler rückwirkend behoben werden. Jene fehlerhaften Angaben, deren Verbesserung das Ergebnis der Buchführung massgeblich verändern würde, werden als qualitative Fehler bezeichnet.
| Gliederungs- vs. qualitative Fehler im Jahresabschluss | |
|---|---|
| Gliederungsfehler | Qualitative Fehler |
| falsche Reihenfolge einzelner Aktiva und Passiva | Überschuldung |
| fehlerhafte Ordnung einzelner Aufwendungen und Erträge | Verlust von Kapital mit rechtlichen Konsequenzen |
| Unrechtmässige Kurzfassung von Posten in der Bilanz oder in der Erfolgsrechnung | unzulässige Verwendung des Gewinns |
| fehlende Gliederung der Rückstellungen | Verletzung von Kreditvereinbarungen |
| Missachtung einer Schwelle | |
| Gewinn anstelle eines Verlustes |
Da das Verfassen eines Jahresabschlusses viele rechtliche Elemente enthält, kann ein Rechtsanwalt für Steuerrecht dabei ein wertvoller Ansprechpartner sein. So kann er nicht nur neue Unternehmer darüber aufklären, welche Inhalte unerlässlich für den jährlichen Abschluss sind, sondern begleitet Sie auch bei der Vorbereitung, der Erstellung und bei der Einreichung. Zudem können Anwälte auch selbst die Verfassung übernehmen, damit sich die Führungskräfte auf andere relevante Aufgaben im Unternehmen konzentrieren können. Beide Möglichkeiten bieten den Vorteil, dass Fehler im Jahresabschluss bestmöglich vermieden oder schneller erkannt und korrigiert werden können. Der Rechtsanwalt kann zudem auch die Prüfung eines bereits verfassten Abschlusses übernehmen, um die Richtigkeit der Angaben sicherzustellen.

Finden Sie in unserer Anwaltssuche den passenden Anwalt
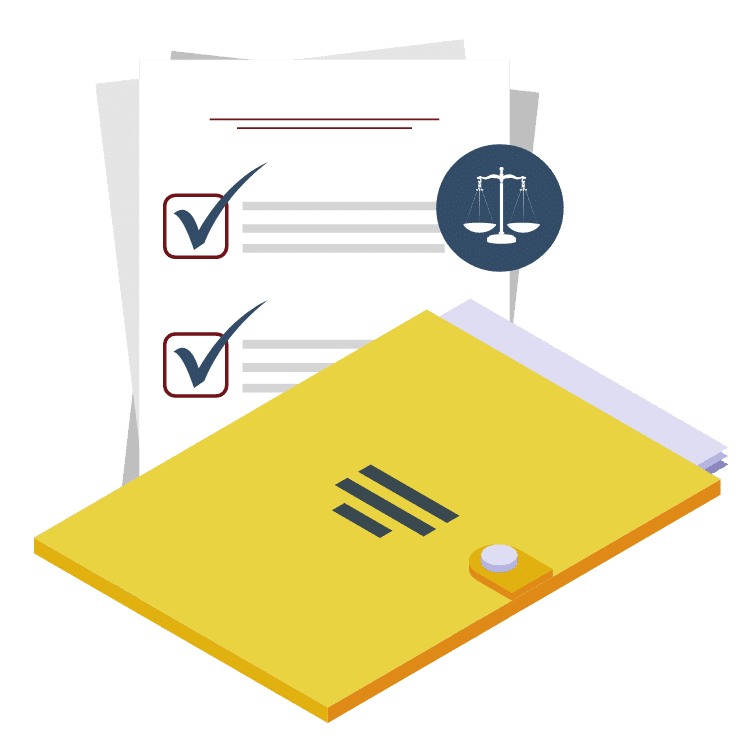
Finden Sie weitere Ratgeber zum Gesellschaftsrecht

Finden Sie in unserer Anwaltssuche den passenden Anwalt
Es ist wichtig, sich so früh wie möglich auf den jährlichen Abschluss mit der Zusammenstellung der notwendigen Unterlagen und dem Sammeln von wichtigen Belegen vorzubereiten. Auch die Überprüfung des Abschlusses durch die zuständige Person oder den Aufsichtsrat muss genau erfolgen, um Fehler rechtzeitig zu erkennen.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung